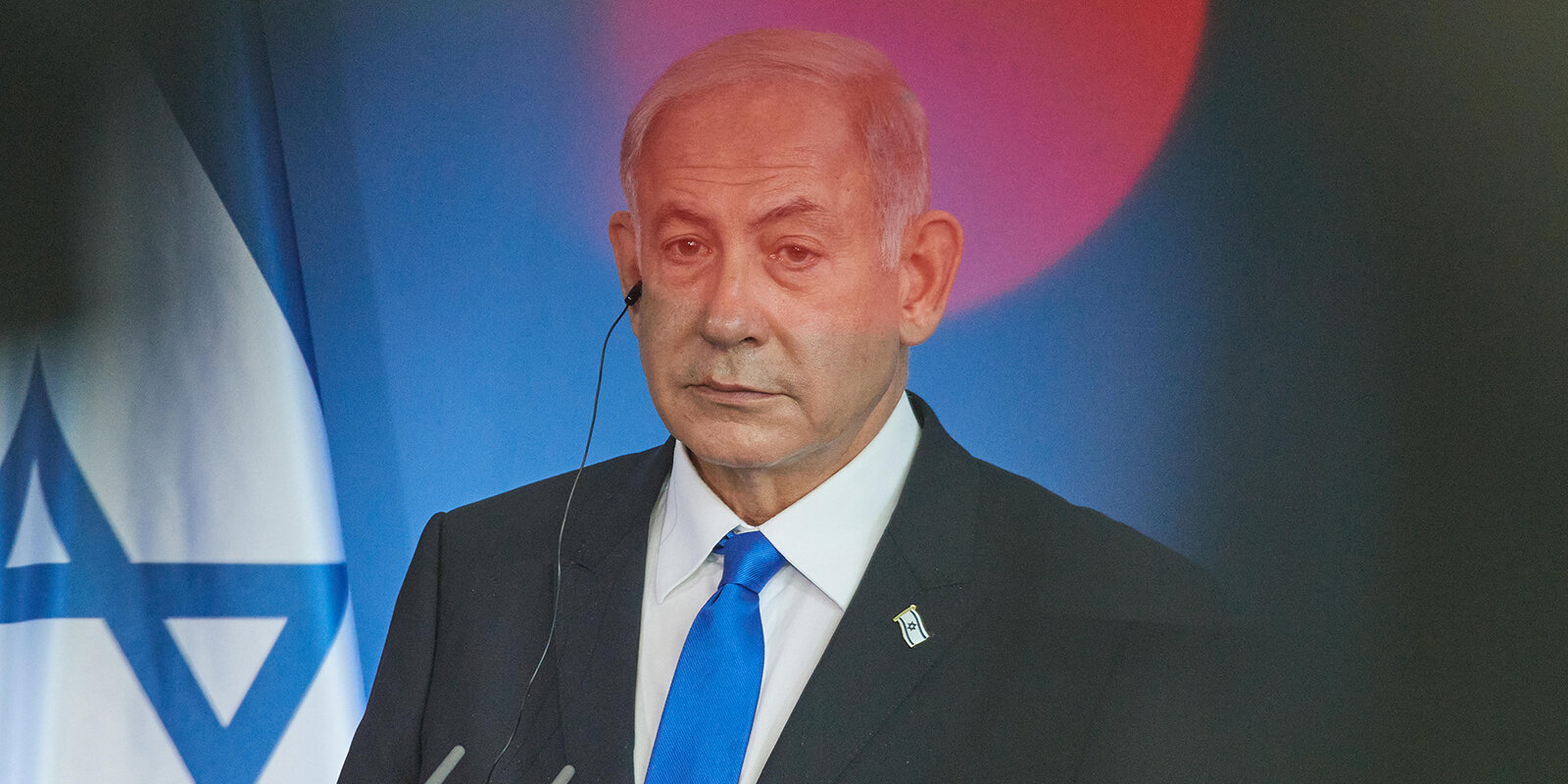Flexibilität à tout prix
Das Wort „flexibel“, das klingt ja an sich gar nicht mal so schlecht. Flexibilität, das klingt nach Offenheit, das klingt nach Spontanität und, ja, auch ein bisschen nach Freiheit. Das Gegenteil von „flexibel“ ist „rigide“ oder „starr“ – und seien wir mal ehrlich, wer will das schon sein?
Flexibilität, das klingt nach Individualität und nach persönlicher Lebensstilanpassung. Kurz: es klingt nach Tugenden, die wir modernen Menschen hochhalten und schätzen, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. In welcher Jobanzeige steht heute nicht, dass man sich vom Kandidaten Flexibilität erwartet? Damit ist die Fähigkeit gemeint, auch einmal auf Unvorhersehbares reagieren zu können, sozusagen improvisieren zu können, und eben nicht nur Dienst nach Vorschrift zu leisten.
Kritische Stimmen könnten allerdings einwenden, dass damit aber eher unbezahlte Überstunden, Arbeit am Wochenende und Peer-Pressure gemeint sind.
Flexibel = Frei?
Ist Flexibilität also gleich Freiheit? Nun, wenn meine Freiheit nur durch die Unfreiheit der anderen ermöglicht wird, dann haben wir es mit einer problematischen Form von Freiheit zu tun. Denn genau das ist ja der Preis meiner Flexibilität, nämlich dass andere dafür ihrerseits unflexibel sein müssen.
Flexiblere Öffnungszeiten bedeuten Sonntagsarbeit für die ArbeiterInnen, und ein flexiblerer congé parental bedeutet längere Abwesenheit am Arbeitsplatz und eventuell Engpässe, die von den anderen getragen werden müssen. Das dürfte, glaube ich, jedem klar sein: Flexibilität hat ihren Preis.
Monochronie
Warum ist die Flexibilität dann so populär? Ich glaube das hat mit der Vorstellung zu tun, dass man sich durch mehr Flexibilität auch mehr Zeit „zurücknimmt“, indem man das Leben nicht an die Zeit anpasst, sondern die Zeit an das eigene Leben. Diese Idee hat wiederum zu tun mit unserer Zeitkonzeption.
Wir Menschen des Westens leben in dem, was der Anthropologe Edward T. Hall als „monochrone“ Gesellschaften bezeichnet. Das bedeutet, dass wir der Zeit als etwas Äußerlichem, als einem Objekt gegenüberstehen. Die Zeit ist für uns etwas, etwas, das man einteilen, planen und organisieren kann. In westlichen Kulturen kann man ja z.B. seine „Zeit verschwenden“ oder „gewinnen“, als sei die Zeit ein Gegenstand, den man haben oder verlieren kann.
Dieses Zeitverständnis wird uns bereits im frühen Alter eingetrichtert. Eltern wissen, dass ein wichtiger Schritt in der Erziehung Kindern ist, das Lesen der Uhr beizubringen. Also: In monochronen Gesellschaften regelt man den Zeitplan der Mitglieder, und zwar so, dass allemal ungefähr denselben Rhythmus haben.
Das muss sein, denn ohne einen gemeinsamen Zeitplan wäre industrieller, wirtschaftlicher und technischer Fortschritt viel schwieriger. Deshalb machen wir Pläne und versuchen sie einzuhalten, und so arbeiten wir uns in die Zukunft hinein.
Aber dieses Zeitkorsett wird von vielen Menschen als sehr beengend empfunden. Ich denke da zum Beispiel an Kreativschaffende, aber nicht nur. Sobald es um individuellen Ausdruck, um Ideen, um Selbstverwirklichung geht, stößt man in unseren Gesellschaften an seine Grenzen.
Polychronie
Ja, neben den monochronen Gesellschaften gibt es nach Hall auch die sogenannten polychronen Gesellschaften, das heißt Gesellschaften, die eine viel größere Toleranz für Gleichzeitigkeit haben. Laut Edward Hall findet man dieses Zeitverständnis Beispielweise in arabischen und in pazifischen Ländern, aber auch in Südeuropa.
In diesen Gesellschaften kann man durchaus zwei Termine gleichzeitig haben, man kann auch stark verspätet zu einem rendez-vous erscheinen, ohne dass das ein Problem darstellt. In diesem Zeitverständnis können sich verschiedene Zeitlinien überlagern. Handlungen auf der einen Timeline können unterbrochen werden, um Handlungen auf einer anderen Timeline nachzugehen.
Starrheit und Dehnbarkeit
In polychronen Gesellschaften herrscht größere Flexibilität, in dem Sinne, dass die Zeit als dehnbar empfunden wird, nach dem Motto: „Wenn nicht jetzt, dann später.“ Diese Gelassenheit hat auch mit einem zyklischen Verständnis von Zeit zu tun hat, nach dem Motto: Alles kommt einmal wieder, alles wiederholt sich, und wenn ich die Chance nicht jetzt ergreife, dann ist das nicht schlimm, weil sie später wiederkommt.
Aber – und das ist der springende Punkt – ein solches Motto ist in einem monochronen und linearen Zeitverständnis nicht angebracht, denn da kommt nichts nochmal wieder, da zählt tatsächlich jeder einzelne Moment. An dieser Stelle wird deutlich, weshalb das mit der Flexibilität in unserer Gesellschaft nicht ganz so einfach ist.
Es ist ja durchaus wünschenswert, dass wir das starre Zeitkorsett unserer monochronen Gesellschaft aufbrechen, dass man mehr freie Zeitgestaltung zulässt. Aber man kann den Spirit der Polychronie nicht einfach so in ein monochromes System übertragen – dafür fehlen uns viele Voraussetzungen.
In polychronen Gesellschaften herrscht zum Beispiel eine ganz andere Vorstellung vom Verhältnis zwischen dem Individuum und dem Kollektiv. In diesen Gesellschaften ist der Einzelne stärker in eine Gemeinschaft eingebettet, und wie man weiß, braucht Bindung Zeit – Zeit, die man nicht in eigene Projekte investiert.
Westliche Gesellschaften, monochrone Gesellschaften, sind auf Zeitoptimierung ausgerichtet. Wir denken uns: wenn ich meine Arbeit effizienter mache, dann habe ich mehr Zeit für mich. Das ist der Geist der Optimierung. Also man sieht: Das sind sehr grundlegende, sehr wichtige Unterschiede, die hier bestehen. Und vielleicht ist die Flexibilisierung, die bei uns praktiziert wird, deshalb so unbefriedigend. Der Zeitplan wird nicht gesprengt oder hinterfragt, er wird nur in kleinere Teile zerlegt und neu verteilt.