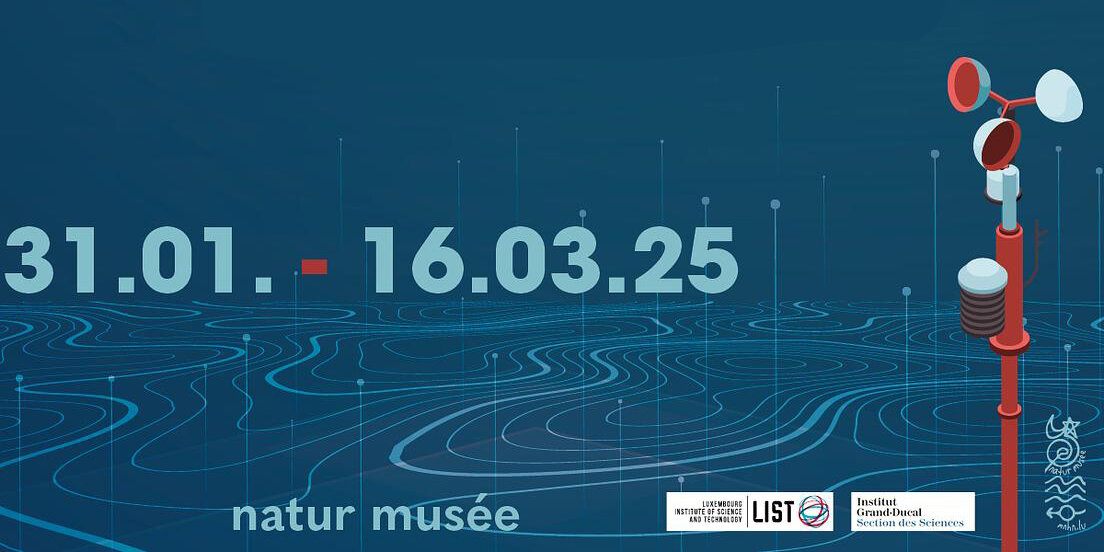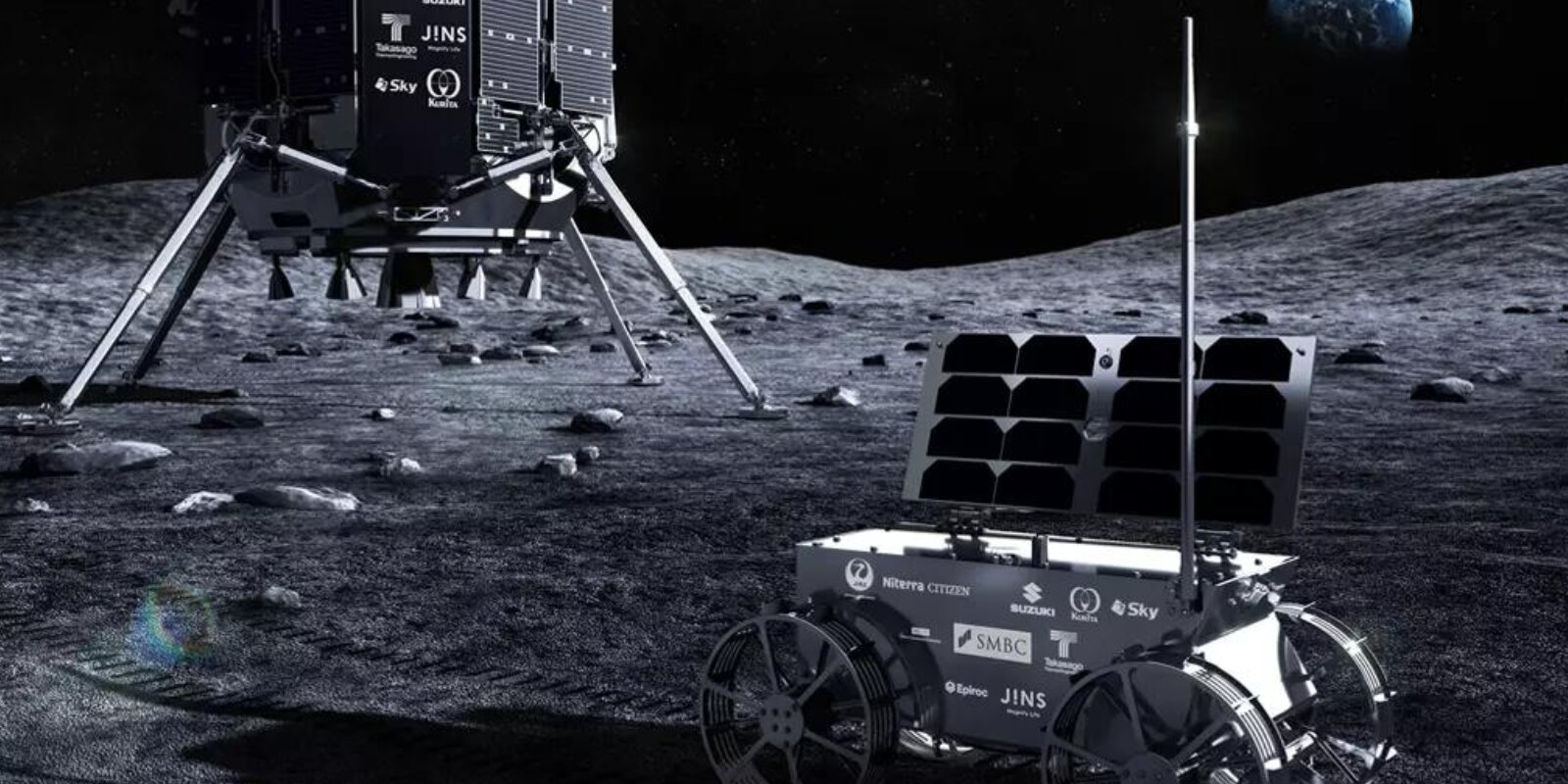Bedauerlicherweise werden viele SchülerInnen in unserem Schulsystem erst im Abschlussjahr, also auf der Première, mit dem Fach Philosophie konfrontiert. Zu diesem Zeitpunkt sind, aufgrund jahrelanger Ausbildung, viele Meinungen schon gefestigt, viele Ansichten schon geprägt, manche davon sogar zur absoluten Wahrheit ausgerufen. Da tut das Fach Philosophie wohl, geht es hier doch darum, diese scheinbar soliden Ansichten zu überprüfen und zu hinterfragen.
Eine dieser soliden Ansichten hält sich besonders hartnäckig – und das nicht nur in SchülerInnenköpfen –, nämlich die Ansicht, dass die Wissenschaft alles sagen und erklären kann, was in der Welt vor sich geht. Diese Position nennt man den Physikalismus, und der sagt, dass alles was geschieht den Gesetzen der Physik gehorcht und sich in der Sprache der Physik ausdrücken lässt. Sogar unsere Gedanken lassen sich dem Physikalismus zufolge in Hirnarealen verorten und beschreiben!
Was sehe ich, wenn ich Farben sehe?
Nun denn, versuchen wir einmal, die Ansicht kritisch zu hinterfragen – und zwar mittels eines Gedankenexperiments des australischen Philosophen Frank Jackson. Stellen Sie sich eine Neurowissenschaftlerin namens Mary vor, deren Forschungsgebiet die Neurophysiologie der Farbwahrnehmung ist. Anders gesagt: Sie erforscht, wie wir Farben wahrnehmen, was Farben sind und was in uns vorgeht, wenn wir rote Tomaten, grüne Bäume oder das blaue Meer sehen. Mary ist eine Koryphäe ihres Fachs und kann diese Prozesse bis ins kleinste Detail physikalisch erklären. Das Ganze hat aber einen Haken: Mary selbst sitzt in einem schwarzweißen Raum und hat sich sich die Welt bisher nur durch einen schwarzweißen Monitor angesehen.
Das heißt: Obwohl Mary alles über Farben weiß, hat sie noch nie selbst eine Farbe gesehen. Nehmen wir an, dass eine gute Seele sie nun aus dieser schwarzweißen Welt befreit. Mary sieht nun zum ersten Mal das Grün der Bäume, das Rot der Tomaten und das Blau des Meeres. Sie hat nun eine sinnliche Erfahrung dieser Farben. Würden wir nicht alle darin übereinstimmen, dass sie nun mehr über diese Farben weiß, als vorher, dass ihr Wissen vorher also unvollständig war? Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Physikalismus eben nicht alles erklären kann, was ist. Die Frage ist dann aber: Was genau weiß Mary nun mehr? Was genau entzieht sich der theoretisch-physikalischen Erklärung? Mary wusst auch schon vorher, dass das Meer blau ist, ebenso blau wie der Himmel. Was also ist das für ein Wissen, das sie nun gewonnen hat?
Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?
Eine ähnliche Frage stellte sich auch der amerikanische Philosoph Thomas Nagel in seinem berühmten Aufsatz „What is it like to be a bat?“, also Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? weiß ja, dass Fledermäuse die Außenwelt durch ein Art Sonar wahrnehmen. Sie senden Schreie in die Nacht, die für uns nicht hörbar sind. Das Echo dieser Schreie gibt der Fledermaus ein klares Bild ihrer Umgebung, was es ihr dann ermöglicht, kunstvoll die kleinen Mücken aus der Luft zu picken, von denen sie sich ernährt. Das alles lässt sich sehr wohl physikalisch erklären – und dennoch lässt es nicht nachvollziehen.
Ich kann mir trotz aller physikalischer Erklärungen nicht vorstellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, da mir es mir nicht möglich ist, ein Sonar zu benutzen um meine Umwelt wahrzunehmen. Ich kann mir vielleicht vorstellen wie es ist, den ganzen Tag in einem dunklen Raum zu hängen, Flügel zu haben, einen pelzigen Körper und große Ohren, ich kann mir vorstellen, wie es für mich wäre, eine Fledermaus zu sein, aber das alles bringt mich der tatsächlichen Erfahrung der Fledermaus nicht näher. Denn die Erfahrungswelt eines Lebewesens ist etwas subjektives. Indem der Physikalismus hingegen versucht, die Dinge objektiv zu beschreiben, muss er hier scheitern.
Unzugänglichkeit
Das ist die Lehre aus diesen beiden Gedankenexperimenten: das geistige Leben eines Lebewesens lässt sich nicht auf dessen körperliches Funktionieren herunterschrauben. Eine noch so detaillierte Kenntnis der Funktionsweise von Farbwahrnehmung oder von Fledermaus-Sonaren gibt mir noch keinen Zugang zu der tatsächlichen Erlebniswelt. Und das bedeutet wiederum, dass mir die Erlebniswelt eines anderen Lebewesens bis zu einem gewissen Grad immer unzugänglich bleiben wird.
Objektiv beschreiben kann ich sie jedenfalls nicht, sondern nur erahnen. An dieser Stelle, an der die Wissenschaft nicht weiter kommt, kann vielleicht die Kunst anknüpfen. Aber das ist ein anderes Thema...